| 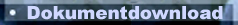 Blackout Blackout
Ein-Mann-Theaterstück in fünf Akten
Der Plot
1. AKT
 Ein
Mann kommt nach Hause und liest seine Post. Eine Vorladung setzt
ihn in Kenntnis, dass er als Augenzeuge eines Verkehrsunfalls benannt
ist und vor Gericht aussagen soll. In einem Telefongespräch
mit seinem Freund, der Anwalt ist, räumt er zwar ein, noch
am Unfallort seine Sicht der Dinge zu Protokoll gegeben zu haben,
lehnt es aber entschieden ab, seine Angaben als Zeuge vor Gericht
zu wiederholen. Er sei außerstande, allein aufgrund seiner
Erinnerung glaubwürdige Aussagen zum Unfallgeschehen zu machen.
In seiner Empörung darüber, dass man so etwas von ihm
verlangt, nimmt er das Publikum selbst in die Zeugnispflicht: Nach
Anhörung seiner Argumente sei es deren Schuldigkeit, seine
Verweigerung als rechtens anzuerkennen und durch ihr Urteil zu beglaubigen. Ein
Mann kommt nach Hause und liest seine Post. Eine Vorladung setzt
ihn in Kenntnis, dass er als Augenzeuge eines Verkehrsunfalls benannt
ist und vor Gericht aussagen soll. In einem Telefongespräch
mit seinem Freund, der Anwalt ist, räumt er zwar ein, noch
am Unfallort seine Sicht der Dinge zu Protokoll gegeben zu haben,
lehnt es aber entschieden ab, seine Angaben als Zeuge vor Gericht
zu wiederholen. Er sei außerstande, allein aufgrund seiner
Erinnerung glaubwürdige Aussagen zum Unfallgeschehen zu machen.
In seiner Empörung darüber, dass man so etwas von ihm
verlangt, nimmt er das Publikum selbst in die Zeugnispflicht: Nach
Anhörung seiner Argumente sei es deren Schuldigkeit, seine
Verweigerung als rechtens anzuerkennen und durch ihr Urteil zu beglaubigen.
Dann zählt er seine Argumente auf:
- Die vorschnelle Aussage suggeriere ihm den Glauben an seinen
unmittelbaren Eindruck und verhindere so die objektive Einschätzung
des Geschehens.
- Die am Unfall beteiligte Frau habe sein männliches Interesse
geweckt und mit ihren Reizen vom wahren Sachverhalt abgelenkt.
- Es sei einfach unwahrscheinlich, dass er seine Aufmerksamkeit
ausgerechnet auf die flüchtigen, für ihn unwichtigen,
aber für die Schuldfrage relevanten Aspekte gelenkt habe.
- Seine Erinnerung sei spekulativ, weil getrübt durch Wahrscheinlichkeit
und Vorurteile, derer er sich nicht erwehren könne. So zum
Beispiel dem Umstand, dass ebenso unerfahrene wie forsche Autofahrer
zu Übertretungen neigten.
Aufgrund dieser Argumente sei klar, dass Erinnerungen nichts bezeugten
und seiner Vorladung deshalb widersprochen werden müsse.
2. AKT
Um die Unzuverlässigkeit des Abrufens erinnerter Erlebnisse
zu veranschaulichen, fordert er das Publikum auf, sich Ihrer ersten
drei Worte nach dem morgendlichen Erwachen zu erinnern. Die Schwierigkeit
dieser Aufgabe bestehe gerade in dem irrelevanten Kriterium des
Abrufs: Weil niemand seine Erinnerungen maßstabsgerecht abspeichere,
sei es auch nicht möglich, sie nach geordneten Parametern abzurufen,
wie zum Beispiel nach der Uhrzeit. Mögliche Lücken in
den erinnerten Sequenzen müssten in Kauf genommen werden. Und
das mache den Augenzeugenbericht unglaubhaft.
Er geht noch weiter: Darüber hinaus, dass die Erinnerung ein
unvollständiges Bild liefere, seien wir auch außerstande,
die Dinge um uns überhaupt objektiv wahrzunehmen. Anhand eines
Posters in seiner Wohnung - Porträt eines jungen Mädchens
im Pop-Art-Stil - veranschaulicht er seine These: Dieses Mädchen
sei ebenso Kunstwerk wie emotionaler Schlüsselreiz, die Linien
ihrer Gesichtszüge einerseits nichts weiter als chaotische
Bildpunkte, andererseits ein vom Betrachter als aufreizendes Lächeln
wahrgenommenes Muster.
Im Gegensatz zu der künstlichen Intelligenz des auf seinem
Schreibtisch stehenden Computers, der seinen Input eindeutig nur
auf einer Datenebene verarbeite, sei der Mensch in der Lage und
gezwungen, sich auf verschiedenen Bedeutungsebenen zu bewegen. Das
mache den Menschen aus. Und das impliziere Interpretation, welche
als Beweismittel nicht zugelassen werden dürfe.
3. AKT
Er setzt sich an seinen Schreibtisch, um einen Brief an das Gericht
zu schreiben, will also gegen die Vorladung schriftlich Einspruch
erheben. Beiläufig teilt er dem Publikum mit, dass es seine
Mutter war, die ihn stets gemahnte, wichtige Vorhaben ohne Aufschub
in die Tat umzusetzen. Damit er sie nicht vergesse. Ein mütterlicher
Ratschlag, dessen sträfliche Missachtung ihm ein Leben lang
in Erinnerung geblieben sei. Während die Dinge des täglichen
Lebens trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer wieder verlegt,
vergessen und übersehen würden, komme allein das schlechte
Gewissen niemals abhanden.
Während er noch immer vor dem unbeschriebenen Display seines
Computers sitzt, weil ihm nichts einfällt, erklärt er
seinen Zuhörern die Funktion von Textbausteinen, derer er sich
bei der Erledigung seiner Korrespondenz für gewöhnlich
bedient. Anhand einiger Beispiele demonstriert er, wie gängige
Floskeln mittels ihrer Initialen codiert und abgerufen werden können.
Das vereinfache zwar das Formulieren, überfordere aber wiederum
das Gedächtnis, weil die gesuchten Codewörter immer wieder
in Vergessenheit gerieten. Dann müsse man nachschlagen, was
unbequem sei und ihn am Sinn dieser Textbausteine zweifeln lasse.
Trotzdem entwirft er die Utopie einer besseren Welt, in der durch
die Verbesserung der digitalen Systeme alle möglichen Formulierungen
elektronisch gespeichert und jederzeit abrufbar wären.
Dann tippt er spontan den ersten Satz seines Briefes und lobt die
Intuition seines Tuns. Was ihn zum nächsten Gedanken führt:
dass jede, auch noch so spontan erscheinende, Eingebung nichts weiter
als ein abgeleiteter Gedanke sei, eine Assoziation im weitesten
Sinn. Er selber führe es vor, als der Mann auf der Bühne,
der von einem Gedanken zum nächsten gleite. Von eben dieser
Gedankenkette könne sich keine Überlegung lösen,
was die Freiheit der Denkens rigoros beschneide. Zur Veranschaulichung
fordert er seine Zuhörer auf, einen zufälligen Gedanken
zu denken, und bestreitet zugleich, dass dies irgendjemandem im
Publikum gelänge. Die Erinnerung sei der sich abspulende Film
einer solchen Gedankenkette, in der sich eingeschränkte Schnappschüsse
des realen Geschehens aneinanderreihten. So auch im Augenzeugenbericht.
Die Erinnerung sei eben keine Liveübertragung und deshalb als
Beweismittel unbrauchbar.
|
|
4. AKT
Der Mann auf der Bühne erklärt sich jetzt außerstande,
den Brief ans Gericht zu schreiben. Die Sprache, so erklärt
er, sei ohnehin kein adäquates Mittel, seine Eindrücke
zu kommunizieren. Das Gehirn sei in erster Linie ein Fotoarchiv.
Zur Demonstration zeigt er eine Fotografie: ein Porträt seiner
Mutter. Zwei Sekunden der Betrachtung genügten, um dasselbe
Gesicht unter vielen anderen wiederzuerkennen. Trotzdem sei niemand
unter seinen Zuschauern in der Lage, das Gesehene in Worte zu fassen.
Es sei einfach nicht möglich, Bilder verbal zu formulieren.
Was den Augenzeugenbericht hinfällig mache.
Im zweiten Schritt seiner visuellen Demonstration zeigt er das Porträt
seiner Mutter als überzeichnete Karikatur. Das Gesicht wird
zur Fratze, ist aber immer noch als ein Ausdruck derselben Person
zu identifizieren. Er weist seine Zuschauer darauf hin, dass dem
Zeichner im Gegensatz zum Fotografen nur wenige Striche genügten,
um die zur Identifikation relevante Information zu verpacken. Jedoch
könne niemand sagen, wo genau diese Information sich befinde.
Bilder seien eben Kompositionen, genau wie Melodien, die sich nicht
in Ihre Einzelteile zerlegen ließen.
Wieder und wieder kehrt er zum selben Thema zurück, was sich
auch in den gezeigten Bildern widerspiegelt: seine Mutter. Ihre
Visage biete ihm den nicht benennbaren Schlüsselreiz, den Code,
der unzählige Assoziationen auslöse. Das funktioniere
nach demselben Prinzip, in dem ausformulierte Textbausteine codierte
Information entschlüsselten. Allerdings seien die Inhalte dieser
Assoziationen nicht absehbar. Das sei überhaupt das Schlimme,
dass wir keinen Einfluss hätten auf unsere Erinnerungen, keine
Macht darüber, wie und wo wir sie ablegten, oder wann wir sie
ebenso unwillkürlich wieder abriefen. Der Beweis hierfür
sei augenblicklich nachvollziehbar: Niemand seiner Zuschauer sei
in der Lage, den Augenblick selbst in sein dauerhaftes Langzeitgedächtnis
zu befehlen.
Er entwickelt seinen Gedanken weiter vom Abspeichern zum Abrufen.
Dieses undurchsichtige Langzeitgedächtnis stehe uns als Erinnerungsarchiv
zur Verfügung, auf dessen Daten wir nach Bedarf zurückgreifen.
Das Problem daran sei nun wiederum, dass neu hinzukommendes Material
in erlernte Erwartungsmuster eingepasst werde. Der zwanghafte Wunsch
nach Sinn und Bedeutung nötige uns, das wahrgenommene Geschehen
mit bekannten Mustern unseres Archivs zu vergleichen und entsprechend
einzuordnen. Er beschwört damit ein Dilemma herauf: Denn erlernte
Irrtümer setzen sich auf diese Weise immer weiter fort. Wir
seien unentwegt befangen durch Voreingenommenheit, indem wir einfach
nur sehen, was wir sehen wollen: in dem Porträt des Postergirls
die Projektion unserer eigenen Gelüste und im Straßenverkehr
die Schuld des aggressiven Autofahrers.
Und die begangenen Irrtümer reihten sich Tag für Tag aneinander,
wie das Strickmuster einer Serie im Vorabendprogramm, in dem alle
Rollen nach gut und böse auf das Ensemble verteilt seien.
Doch diese ständigen Wiederholungen, so beklagt er, seien -
im Fernsehen wie im Leben - auf Dauer öde und langweilig. Zwar
seien sie notwendig, um Erfahrungen überhaupt verwertbar zu
machen, in unserer Erinnerung jedoch spielten sie nur noch eine
untergeordnete Rolle. Allein das Neue, das Überraschende werde
noch ausführlich abgespeichert. Er zeigt das Bild einer Wüstenlandschaft,
in der eine fruchtbare Oase den Ausbruch aus dem Alltäglichen
symbolisiert. Ein Urlaub sei zum Beispiel eine solche Oase, die
uns detailliert in Erinnerung bleibe. Aber die so gesetzten Prioritäten
brächten noch mehr durcheinander mit sich, indem sie die realen
Abläufe neu strukturierten. Die Brunnen der Oasen seien nicht
einfach so vorhanden, sondern würden als solche erst gebuddelt.
Er führt den Gedanken mit weiteren Bildern aus und kommt über
das Postermädchen wieder zurück zu seiner Mutter, deren
Person aus den genannten Gründen nur noch das Abbild seiner
unwillkürlichen Assoziationen sei, eine fiktive Identität
seiner eigenen Interpretation.
5. AKT
Nachdem er sich offensichtlich schon zu Bett begeben hatte, kehrt
der Mann noch einmal auf die Bühne zurück: Er hat etwas
vergessen, das er jetzt nachholt. Er bereitet sein Frühstückspaket
für den nächsten Bürotag vor, womit er wiederum einen
Auftrag seiner Mutter befolgt: Die Vorbereitungen für den morgigen
Tag schon am Abend zu erledigen. Damit sie nicht vergessen werden.
Dabei erinnert ihn der Kaffeefilter in seiner Hand an eine Szene
aus seiner Vergangenheit: den letzten Plausch mit Erika, seiner
Ex-Freundin. Die habe ihn verlassen, weil er sie nicht heiraten
wollte. Noch nicht - nach fünf Jahren. Er sei ihr zu schwammig
gewesen, habe sie behauptet. Aber er sei der Meinung gewesen, dass
man das Wechselbad einer fünfjährigen Liebesbeziehung
schlecht mit einem Treueschwur bilanzieren könne. Die Trauzeugen
könnten umfallen. Wahrscheinlich, so diagnostiziert er, habe
sie einfach andere Erfahrungen gesammelt und auf verschiedene Erinnerungen
zurückgegriffen. Deshalb habe man aneinander vorbeigeredet.
Er kommt zu dem Schluss, dass Erika ihm nichts zugetraut habe, wie
all die anderen Frauen auch. Er beklagt sein Dilemma: Die Frauen
haben ihn verlassen wegen seiner Vorbehalte, die sie doch selbst
verursachten, indem sie immer alles besser wussten.
Er kommt von diesem quälenden Gedanken einfach nicht los. Das
seien die Dämonen: Erinnerungen, die einen niemals loslassen.
Während das, was man festzuhalten bemüht sei, sich allzu
leicht verflüchtige, weiche das, was man gerne aus seinem Gedächtnis
streichen würde, nicht aus dem Bewusstsein. Wie beim Vokabellernen
in der Schule: Während die Fremdwörter trotz allen Bemühens
immer wieder in Vergessenheit gerieten, bleibe der Prüfungstermin
selbst stets präsent. Ein Schubfach unserer Erinnerung, das
sich wie von selbst öffne. Und in diesem Schubfach könnten
sich Personen befinden, die Mutter zum Beispiel, oder die Geliebte
- oder beide gemeinsam, was einer fatalen Verwechslung entspräche.
Die Verwechslung, so konstatiert er, sei der Kardinalfehler der
Erinnerung überhaupt.
Mit einem Rundumschlag setzt er zur letzten Runde an, indem er feststellt,
dass unsere Identität und unsere Erinnerungen ein und dasselbe
seien. Das Gedächtnis sei der Kompass, mit dem die Menschen
ihren Standort bestimmten. Nur mit diesem Instrument könnten
wir uns einreihen in das Kausalprinzip, in die Kette von Ursachen
und Wirkungen. Er lässt eine Tasse zu Boden fallen, deren Zerstörung
er in seinen eigenen Gedankenfluss einreiht. Seine Zuhörern
unterstellt er, sich desselben Prinzips bedient zu haben, als sie
nach ihren ersten drei Worten am Morgen fahndeten: Sie hätten
sich den Ablauf ihres Tagesbeginns vergegenwärtigt, um dort
die Motivation für ihre erste Äußerung aufzuspüren.
Und Motivationen seien eben die Ursachen menschlicher Äußerungen.
Er zeigt ein Bild von schwimmenden Seerosen, mit dem er seinen metaphorischen
Vergleich der Erinnerungsoasen in einer Wüste des vergessenen
Alltags modifiziert: Entscheidend ist nunmehr, dass die Rosen, also
die Oasen der Erinnerung, sich unter der Oberfläche aneinanderranken.
Sie schwimmen nicht ziellos im Zeitbrei herum, sondern sind durch
das Prinzip von Ursache und Wirkung aneinandergekettet, wie die
Assoziationen der Gedankenkette. Jede Erinnerung steht in Relation
zu einer anderen. So würden sich die Fehlleistungen aus den
elementaren Einheiten ableiten und zu kosmischen Irrtümern
auswuchern.
Die Idee der relativen Beziehungen führt ihn zurück zu
seinen persönlichen Beziehungen - zu Erika, zu seiner Mutter.
Ausgerechnet für seine Dämonen sei er selbst keine Ursache
wert. Seine Beteuerungen lösen bei ihnen keine Wirkungen aus,
verhallen in einem Vakuum. Man schenkt ihm keinen Glauben. Und das
macht ihn rasend. Bis er umkippt.
Plötzlich will er den Spieß umdrehen, Stellung beziehen
- vor Gericht und im Leben überhaupt. Zeugnis ablegen gegen
seinen Nächsten, Ursache sein für eine gnadenloses Urteil.
Nicht mehr orientierungslos herumpaddeln, sondern das Steuer in
die Hand nehmen. Endlich.
Er öffnet das Fenster, um Luft zu schnappen. Sein Blick fällt
auf die Straße unter dem Fenster. Es ist ein Unfallgeräusch
zu vernehmen. Aber er lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen,
schließt das Fenster, in dem Wissen, dass die Sonne morgen
wieder aufgehe, weil seine Erinnerung ihn das so lehrte. In der
Regel sei das eben so.
Zurück zur
Präsentationsseite
Inhalt / Textauszüge
Das Konzept
|

